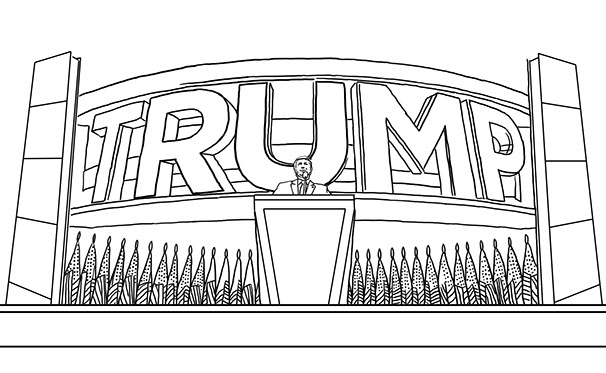US-Wahlkampf – Prinzipien

Illustration: Captain America, Comics No. 1, 1941
Um der Tristesse und Hoffnungslosigkeit der Wirtschaftskrise zu entfliehen entwickelten Medienhäuser und deren Comic-Zeichner in den 1930er Jahren eine ganze Reihe von Superhelden wie Superman, Spider-Man, Batman oder Iron Man. Für das begeisterte Millionenpublikum wurden sie so etwas wie amerikanische Götter und symbolisierten, gerade auch in ihrer Unterschiedlichkeit, die Ideale der amerikanischen Gesellschaft.
Während des Zweiten Weltkriegs repräsentierten die Superhelden, allen voran Captain America, mit einem Kostüm in den Farben der US-Nationalflagge ausgestattet, den amerikanischen Verteidigungswillen, im Krieg und an der Heimatfront.
Im Allgemeinen charakteristisch für amerikanische Superhelden ist, dass sie aus anderen »Welten« stammen, es ihnen schwer fällt sich in der amerikanischen Gesellschaft aufgehoben und akzeptiert zu fühlen, auf Grund eines traumatischen Erlebnisses sich für den radikalen Kampf gegen Verbrechen und Ungerechtigkeit entschieden haben und sie, meist durch äußere Einwirkung (Strahlung), mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Barack Obamas Lebensgeschichte zeigt in vielen Einzelheiten Parallelen zu dem Grund-muster eines amerikanischen Superhelden. Auch er stammt aus einer »anderen Welt.« Aufgrund seiner Hautfarbe hat er sich in seiner Jugend immer wieder als Außenseiter empfunden und nach einer möglichen Rolle und Aufgabe in der Gemeinschaft gesucht. Er behauptet von sich, für eine »bessere Welt« kämpfen zu wollen. In seiner Außenwirkung als mitreißender Redner, mit einem strahlenden Lächeln und einer zur Schau getragenen Energie, die die Illusion erzeugt, er könne Berge versetzen, bietet er sich als Projektionsfläche für diverse heldenhafte Taten an.
Eine Hand voll guter und durchdachter Ideen und Vorsätze hat bislang kaum gereicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. In der deutschen Sprache wird dieser Prozess zu recht als Wahlkampf bezeichnet. Eine Wahlkampagne ist ein lang andauernder, aufwändiger, extrem vielschichtiger Prozess in dem meist ein ganzes Heer an Helfern und Unterstützern und ein gewaltiger Stab an Fachleuten und Beratern sich darum bemüht eine Stimmung zu erzeugen, die am Wahltag zu einer entsprechenden Stimmabgabe führt. Es ist wie ein Rennen, bei dem schlussendlich nur zählt, wer am Ende die Nase vorne hat. Das bedeutet, jeder der Kandidaten wird versuchen so spät wie möglich noch eine Bombe zu zünden, die den oder die Gegner in einem ungünstigen Licht erscheinen lässt. Umgekehrt ist es nodwendig einzelne Trümpfe in der Hinterhand zu behalten, die in entsprechenden Situationen ausgespielt werden können.
Wie bedeutsam ist die Einheitlichkeit einer Kommunikationsstrategie und wie lässt sich solche eine visuelle Konsistenz organisieren und exekutieren, vor allem wenn das Ziel darin besteht, dass sich möglichst viele Menschen selbst aktiv an einem Kommunikationsprozess beteiligen?
Die US-Amerikaner*innen leben in einer Demokratie mit einer Erwartungshaltung an die Durchsetzungskraft eines Präsidenten, als würde er als Monarch uneingeschränkte Macht besitzen. Es wird deshalb von Kandidat:innen erwartet, dass sie verkünden, wie sie das Leben der Amerikaner:innen verändern werden.
Zwei entgegengesetzte Strategien beherr-schen seit je her die Weltpolitik – Angst und Hoffnung. Die Republikaner setzten sich für ein starkes Militär, für Gottesfürchtigkeit, für Waffenfreiheit sowie gegen Homosexualität und Abtreibung ein. Barack Obama wollte die Wahlen mit Optimismus und Zuversicht gewinnen und hat deshalb Feindbilder, wie sonst oft üblich, nicht in den Vordergrund gestellt.
Wenn die Stimme der Wähler:innen zählt, wird in der politischen Propaganda versucht die aktuelle Stimmung dieser Menschen aufzu-greifen, um sie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ein Zusammenleben wird dann als demokratisch empfunden, wenn eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung sich in ihren Interessen wahrgenommen fühlt und sie den Eindruck gewinnt, dass sie in der einen oder anderen Form Vorteile aus ihrer Eingliederung erlangt. Dies bedeutet, unangefochten bleiben jene Positionen, denen es gelingt, sich als Repräsentanten allgemein akzeptierter Vorstellungen zu positionieren. Da sich die Lebenserfahrungen der Menschen durchaus deutlich unterscheiden können, kommt es darauf an möglichst abstrakte Vorstellungen zu präsentieren, die als verbindende Überzeugungen angesehen werden.
Es lässt sich beobachten, dass sich die Anforderungen an Kandidat:innen mit der Veränderung der Mediennutzung gewandelt haben. Für Harry Truman war im Wahlkampf 1948 noch die Eisenbahn eines der Möglich-keiten um möglichst viele Menschen auf 31.000 Bahnhöfen zu erreichen. Die persönliche Begegnung bei Wahlveranstaltungen hat bis heute sicherlich nicht an Bedeutung verloren. Neue Optionen potentielle Wähler:innen zu erreichen, haben sich jedoch entwickelt. Jedes neue Medium hat den Wahlkampf in den USA grundlegend verändert. Im Jahr 1924 war es das Radio, 1960 das Fernsehen. 2008 prägten Facebook und Twitter den politischen Wettbewerb.
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, müssen die Botschaften einerseits eine nach-vollziehbare Ausrichtung aufweisen und andererseits für unterschiedlichste Interpreta-tionen und Assoziationen offen sein, denn es muss gelingen, Menschen die sich mit kontro-versen Lebensumständen konfrontiert sehen, gleichermaßen zu faszinieren. Ihren Alltag erleben viele Menschen als »undurchsichtig«. Er wird bestimmt durch offene Fragen, Ungewissheiten, Risiken, Bedohungen etc. Dementsprechend erscheinen all jene Botschaften als attraktiv, die so etwas wie »Ordnung« in widersprüchliche Diskurse bringen, wenn die Menschen den Eindruck gewinnen, plötzlich sei etwas klarer und eindeutiger geworden. Mehr noch als Argumen-te sind es emotionale Stimmungen, die Menschen zusammenführen. Sie erleben sich dann als geeint in gemeinsamer Hoffnung oder Angst. Medienmacht gewinnt demnach, wer es versteht Emotionen zu provozieren.